
Fünf Tipps, wie Sie hybride Teams führen
Immer mehr Teams arbeiten heute hybrid – mal im Büro, mal remote. Das stellt Führungskräfte vor neue Herausforderungen: Wie bleibt das Team verbunden? Wie gelingt der Informationsfluss? Führungskräftetrainer Mario Müller gibt fünf praxisnahe Tipps, wie Zusammenarbeit und Teamgeist im hybriden Arbeitsalltag gelingen.
Die Zukunft der Arbeit ist hybrid – und damit wird die Gestaltung von Unternehmenskultur und Beziehungen zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Studien zeigen: Gerade in Zeiten von Veränderung und Unsicherheit sind beziehungsorientierte Führung, Vertrauen, Autonomie und Teamzusammenhalt ausschlaggebend für Produktivität und Motivation.
Beschäftigte bleiben, wenn sie sich einbringen und mitgestalten können – nicht, wenn sie kontrolliert werden. Wer Werte vorlebt, konsequent in Beziehungen investiert und Raum für Zusammenarbeit schafft, macht hybride Teams stark und Unternehmen krisenfest. Denn in einer flexiblen, beweglichen Arbeitswelt sind es stabile Beziehungen und echter Zusammenhalt, die Unternehmen zukunftsfähig machen.
Hier sind fünf praxisnahe Tipps, die Sie dabei unterstützen, diese Voraussetzungen für erfolgreiche hybride Teams in Ihrem Unternehmen zu schaffen:
1. Vernetzungsdichte erhöhen
Die Bindungskräfte, die verhindern, dass Ihre Mitarbeiter:innen beim ersten attraktiven Angebot durch die Konkurrenz weg sind, entstehen durch Kontakte und informellen Austausch. Damit Menschen im mobilen Office oder Homeoffice nicht abgehängt werden und sich emotional entkoppeln, brauchen sie regelmäßige Videocalls und -konferenzen, bei denen sie sich gegenseitig sehen und hören können.
Richten Sie zudem Online-Teamevents ein, bei denen auch private Themen auf den Tisch kommen. Eine private Bindung zum Unternehmen kann nur entstehen, wenn man sich dort auch für den privaten Menschen und sein Leben interessiert und nicht ausschließlich für seine Arbeitskraft.
Richten Sie im Wochenplan eine virtuelle Kaffeepause ein, wo Mitarbeiter:innen aus dem Büro und aus dem Homeoffice sich regelmäßig treffen und informell austauschen können, damit kein Graben entsteht zwischen den Anwesenden und den Abwesenden.
"Burnout ist ein individuelles Schicksal. Aber ob es dazu kommt, hängt nur zu einem Bruchteil vom Workload ab. Die Forschung legt nahe, dass Burnout am besten auf der organisationalen und systemischen Ebene angegangen wird. Das heißt: Das Unternehmen muss sich auch dem Menschen anpassen, nicht nur umgekehrt." Mario Müller, Führungskräftetrainer
2. Informationsfluss gewährleisten
Mit hybriden Arbeitsmodellen vermischen sich heute verschiedene Informationskanäle: Flurfunk, Kaffeeküchengespräche, Videocalls und Teammeetings laufen parallel. Dadurch steigt das Risiko, dass wichtige Informationen vorausgesetzt, aber nicht an alle weitergegeben werden.
Führe deshalb in Meetings eine feste Status-Runde ein, in der zentrale Informationen wiederholt und protokolliert werden, damit nichts verloren geht. Orientiere dich an der Spotify-Methode: Vernetze Mitarbeitende nicht nur nach Teams, sondern auch nach Projekten, Kompetenzen und Interessen. So bleibt der Austausch lebendig, Silos werden vermieden und das Wir-Gefühl gestärkt.
Nach der Pandemie ist klar: Es reicht nicht mehr, nur auf einzelne Belastungen zu schauen – jetzt ist der Moment, um zu prüfen, wie es den Mitarbeitenden wirklich geht und wie groß die psychischen Belastungen tatsächlich sind (1). Auch Unternehmen selbst stehen auf dem Prüfstand: Wie gut haben Organisation und Kultur die Krisenjahre überstanden? Was muss angepasst werden, um künftig resilient zu bleiben?
Viele Menschen haben ihr Leben und ihre Arbeit neu bewertet. 2020 wurden in Deutschland so viele Kinder geboren wie zuletzt 1998 (2). Weltweit wollen 41 % der Beschäftigten innerhalb der nächsten zwölf Monate den Arbeitgeber wechseln, 48 % denken sogar über einen kompletten Branchenwechsel nach (3).
Gehalt spielt dabei nur noch eine Nebenrolle – es landet in Umfragen erst auf Platz sieben der wichtigsten Jobfaktoren (4). Ganz oben stehen heute: gute Führungskultur, Wertschätzung und Teamzusammenhalt. Wer hier nicht investiert, verliert Talente an die Konkurrenz.
Unternehmen sind durch Bewertungsplattformen transparenter denn je. Eine starke, gelebte Unternehmenskultur ist deshalb kein „Nice to have“, sondern ein entscheidender Teil des Risikomanagements und der Zukunftssicherung.
3. Ihr Führungsstil: Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser
Führungskräfte, die auf Kontrolle und Micromanagement setzen, haben es zunehmend schwer, da sie damit weder den Interessen der Mitarbeitenden noch des Unternehmens gerecht werden. Unternehmen meistern komplexe Aufgaben nur durch Teams, die ihre Kompetenzen bündeln und gemeinsam mehr erreichen als allein.
Die Hauptaufgabe von Führungskräften ist es, Teams zu befähigen, möglichst eigenverantwortlich und produktiv zu arbeiten. Dazu braucht es Vertrauen und die Bereitschaft, Kompetenzen abzugeben – denn Kontrolle bremst Prozesse und mindert Motivation. Wer Teams Freiräume gibt, fördert Engagement, Innovationskraft und Leistung.
"Unternehmen suchen sich keine Leute mehr aus. Menschen suchen sich Unternehmen aus. Die Kompetenzen verlagern sich von den Führungskräften weiterhin in Richtung der Teams. Führungskräfte müssen in allererster Linie die Kooperation ihrer Teams optimieren und von der Sache nur so viel verstehen, dass sie Entscheidungen (mit) treffen können. C-Level-Management muss Werte vorleben, um glaubwürdig zu bleiben.“
Mario Müller, Führungskräftetrainer
4. Gemeinsame Werte in hybriden Teams
Werte und Leitsätze auf Tafeln im Eingangsbereich sind nutzlos, wenn sie nicht im täglichen Miteinander gelebt werden. Neue Mitarbeitende merken schnell, wie es wirklich im Unternehmen zugeht – und ob Werte wie Respekt, Wertschätzung und konstruktive Zusammenarbeit tatsächlich praktiziert werden. Solche Werte können nicht verordnet oder vorgetäuscht werden, sie entstehen durch authentisches Verhalten und echte Haltung.
Führungskräfte sind automatisch Vorbilder: Ihr Handeln prägt die Teamkultur, nicht ihre Worte. Besonders in hybriden oder digitalen Teams zeigt sich, ob echter Zusammenhalt besteht – oft sind fehlende Verbundenheit oder mangelndes Teamwork schon vor der Homeoffice-Phase ein Problem gewesen.
Der Aufbau einer starken Kultur beginnt immer bei einem selbst: Wer Zusammenhalt und Werte fordert, muss sie auch selbst vorleben und sich regelmäßig hinterfragen. Echtes Teamwork und eine gesunde Kultur sind das Ergebnis von Haltung und täglicher Investition – und kein Selbstläufer.
"Insbesondere die junge Generation ‚hat keine Work-Life-Balance und will auch keine. Junge Leute verstehen Arbeit und Produktivität als integralen Bestandteil ihres Lebens, sie ‚leben auch bei der Arbeit‘ und sind nicht bereit, willkürliche Qualen zu erdulden, um zwischen den Bürozeiten zu leben."
Mario Müller, Führungskräftetrainer
5. Retrospektive einführen, ausprobieren und darüber sprechen!
In vielen Führungsetagen herrscht jetzt eine große Offenheit für Veränderungen. Als Führungskraft können Sie mutig neue Schritte mit Ihrem Team wagen und gemeinsam erfahren, wie sich bestimmte Maßnahmen auswirken. Nutzen Sie die Gestaltungsspielräume, die Sie haben. Versuche zeigen, dass man auch in riesigen, trägen Hierarchiestrukturen agile Inseln und wertebasierte Führung aufbauen kann. Gehen Sie in kurzen Abständen mit Ihrem Team in die Retrospektive, zum Beispiel monatlich – um gemeinsam auf die vergangenen Wochen zu blicken.
Dabei ist es auch wichtig zu fragen, welche Bedürfnisse nach persönlichem Austausch und Kontakt einzelne Mitarbeiter:innen haben, und die Form der Zusammenarbeit dementsprechend auszutarieren.
Gehen Sie mit folgenden Fragestellungen in die Retrospektive:
- Wie haben wir die zurückliegenden Wochen unserer Zusammenarbeit erlebt?
- Was hat sich bewährt? Was behalten wir bei?
- Was lassen wir los?
- Was nehmen wir neu auf?
Hybrides Arbeiten ist heute Standard – die Vorteile von mobilem und virtuellem Arbeiten sind zu groß, um darauf zu verzichten (5). Beschäftigte in Deutschland sparen im Schnitt 24 Tage Pendelzeit pro Jahr (6). Gleichzeitig bleibt persönlicher Kontakt für Vertrauen und Teamzusammenhalt wichtig. Das optimale Verhältnis zwischen Büro und Remote-Arbeit ist flexibel und richtet sich nach den Bedürfnissen von Team, Aufgabe und Situation. Ein starres Modell passt nicht für alle – gefragt sind individuelle Lösungen.
Quellen:
Our burnout moment is a good thing
Work Trend Index, Edelman Data x Intelligence





.jpg/fb7f787c-eedf-ffcd-f11e-bfe0d28ca1fd/fb7f787c-eedf-ffcd-f11e-bfe0d28ca1fd?imageThumbnail=2)

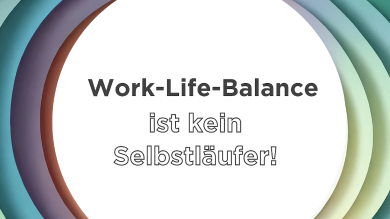
_webgross(1).jpg/10dbece7-f75e-676f-e65a-f42a205733a3/10dbece7-f75e-676f-e65a-f42a205733a3?imageThumbnail=2)

